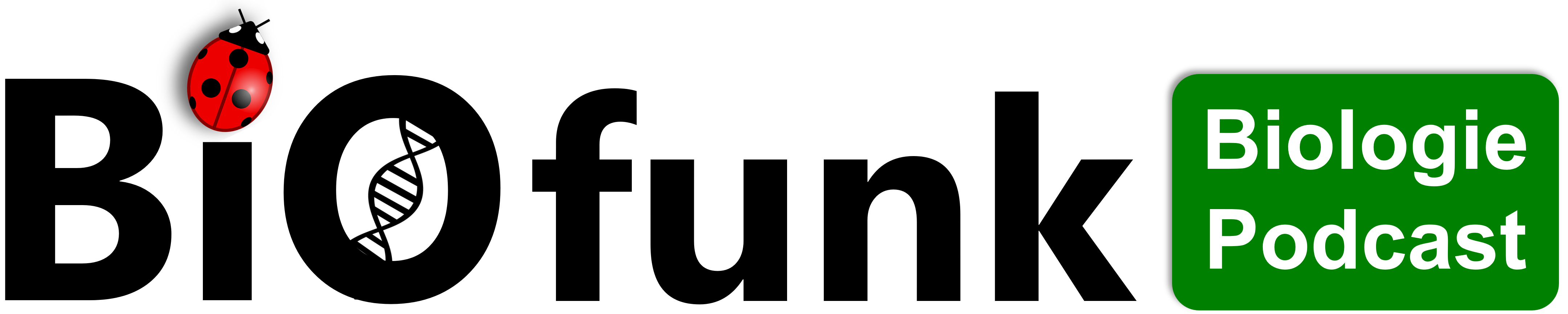Vor gut 25 Jahren kam das erste gentechnisch veränderte Lebensmittel auf den Markt. Der Produktname war Flavr Savr, besser bekannt als Anti-Matsch Tomate. Bereits drei Jahre nach der Markteinführung verschwand diese Tomate wieder und ist heute praktisch vergessen. Die Antimatsch-Tomate als Produkt ist gescheitert, dabei war sie aus verschiedenen Gründen ein Beispiel für eine bessere grüne Gentechnik. Um einige dieser Gründe soll es heute gehen. Betrachten wir zunächst die konventionelle Herstellung von Tomaten.
Zur Podcastfolge
Das Problem mit den roten Tomaten
Sonnengereifte, rote knackige Tomaten hängen am Stock. Die aromatischen Früchte werden sorgsam geerntet und können kurze Zeit später im Supermarkt gekauft werden. Lecker. Und leider leider nicht wahr. Sehen wir der Realität ins Auge. Die Tomaten werden unreif geerntet, also als grüne Tomaten. Dann werden sie in das Zielland transportiert. Dort werden sie mit dem Gas Etyhlen behandelt. Die grünen Tomaten reifen fern vom Stock und der Sonne des Südens zu roten Tomaten heran, werden verpackt und im Supermarkt verkauft. Ob sie aromatisch sind, ist eine andere Frage. Zu dieser Vorgehensweise gibt es leider kaum eine Alternative. Tomaten wachsen besonders gut in südlichen Ländern und müssen dann oft über weite Wege transportiert werden. Und reife rote aromatische Tomaten überstehen den Transport nicht. Sie werden weich und die Oberfläche brüchig. Pilze und Bakterien dringen ein und lassen die Tomaten verfaulen. Und wer kauft schon Tomatenmatsche. Deshalb werden die Tomaten unreif geerntet, denn in diesem Zustand kann man sie gut transportieren. Mit den beschriebenen Nachteilen.
Das Problem ist, dass die Tomatenreifung, also die Entwicklung der roten Farbe und des vollen Aromas, an Abbauvorgänge gekoppelt ist. Die Tomaten werden dabei weich und angreifbar für Fäulniserreger. Und hier setzten die Entwickler der Antimatschtomate an: Tomatenreifung ohne Abbauvorgänge, das war das Ziel. Dann könnte man reife Tomaten ernten, die den anschließenden Transport gut überstehen würden. Sie wären länger haltbar und der Verbraucher bekäme aromatischere Tomaten. Zunächst mussten die Wissenschaftler der Biotechfirma Calgene die Abbauvorgänge besser verstehen. Sie suchten nach dem Auslöser. Und sie wurden fündig: Schuld war ein Enzym, nämlich die Polygalacturonase. Damit hatten die Wissenschaftler einen Ansatzpunkt für die Entwicklung der Antimatschtomate.
Der Plan gegen den Matsch
Das Enzym Polygalacturonase baut den Zellwandbestandteil Pektin ab. Dadurch wird die Zellwand geschwächt und eher durchlässig für Fäulniserreger. Gleichzeitig wird die Tomate weich und empfindlich gegenüber Stößen etc. Schnell kommt es zu Fäulnis und schließlich zu Tomatenmatsche. Der Plan zur Herstellung einer Antimatschtomate war naheliegend: Das Enzym Polygalacturonase musste ausgeschaltet werden. Sprechen wir vereinfacht vom Matschenzym. Die Wissenschaftler von Calgene wählten hierfür eine elegante molekularbiologische Methode: Sie arbeiteten mit sogenannter Antisense-RNA. Zum Verständnis ein kleiner Exkurs zur Proteinherstellung in Zellen. Der Bauplan für das Matsch-Enzym liegt auf einem Gen im Zellkern. Die Proteinfabriken, also die Ribosomen sind dagegen im Cytoplasma außerhalb des Zellkerns. Deshalb wird zunächst eine Kopie des Bauplans in Form von einzelsträngiger mRNA hergestellt. Die mRNA geht von Zellkern ins Cytoplasma und dockt an ein Ribosom an. Das Ribosom stellt das Enzym gemäß dem von der mRNA gelieferten Bauplan her. Die Wissenschaftler zerstörten nun nicht das Gen für das Matschenzym im Zellkern, sondern sie sorgten dafür, dass die mRNA mit dem Bauplan nicht mehr an das Ribosom kommt. Sie nutzen das Bakterium Agrobakterium tumefaciens als Genfähre. Damit bauten sie eine weitere Kopie des Matschgens in das Erbgut der Tomatenpflanze ein, aber so dass die Sequenz, also die Abfolge der Basen umgedreht war. Dadurch wird nicht der DNA-Strang mit dem Protein-Bauplan kopiert, sondern der gegenüberliegende DNA-Strang, der Gegenstrang. Und der Begriff Antisense bedeutet nichts anderes als Gegenstrang. Jetzt entstehen in der Zelle zwei Matschenzym-mRNAs. Die normale Matschenzym-mRNA und die dazu passen Antisense-mRNA. Und diese beiden einzelsträngigen mRNAs können sich aneinanderlagern und einen Doppelstrang ausbilden, eben weil die Gegenstrang-mRNA sich über Basenpaarung an die eigentlich mRNA anlagern kann. Mit dieser doppelsträngigen mRNA kann das Ribosom nichts anfangen, deshalb wird das Matschenzym nicht mehr hergestellt. Das Verfahren war sehr effektiv. In den gentechnisch veränderten Tomatenpflanzen wurde 100-mal weniger Matschenzym hergestellt. Und das machte die Tomaten tatsächlich länger haltbar. Sie verfaulten deutlich später als konventionelle Tomaten. Eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Und eigentlich ein Beispiel für eine bessere grüne Gentechnik. Kommen wir zu den Gründen.
Was für die Antimatsch-Tomate sprach
Gentechnik wird häufig mit dem Einbau artfremder Gene gleichgesetzt. Zum Beispiel wird ein Fischgen in eine Pflanze eingebaut. Und dieses Überspringen von Artgrenzen beunruhigt viele Menschen. Und damit lassen sich auch bewusst Ängste schüren. Aber diese Vereinfachungen führen nicht zu einer aufgeklärten Diskussion über die Risiken und Chancen der grünen Gentechnik. Meiner Meinung nach sollte man den Einzelfall betrachten. Grüne Gentechnik an sich ist nicht gut oder schlecht, gefährlich oder ungefährlich. Man muss jeweils konkret betrachten, welche gentechnische Veränderung tatsächlich durchgeführt wurde, um mögliche Folgen zu beurteilen.
Bei der Antimatschtomate wurde kein artfremdes Gen eingebaut. Die Pflanze hat auch keine neuen Eigenschaften bekommen. Im Gegenteil: Es wurde ein tomateneigenes Gen ausgeschaltet. Und zwar indem eine weitere Kopie des Gens in die Pflanze übertragen wurde. Die Risiken, die von einer solchen Pflanze ausgehen sind wohl eher als gering zu bewerten. Pflanzenzüchter hatten zuvor versucht, dieses Matschenzym durch konventionelle Züchtung auszuschalten. Also ohne Gentechnik. Sie haben es aber nicht geschafft, ohne das weitere negative Eigenschaften in den so gezüchteten Pflanzen auftraten. Bei der Antimatschtomate konnte dagegen gezielt das Enzym ausgeschaltet werden, ohne negative Folgen für die Tomatenqualität. Damit taugt die Antimatschtomate meiner Meinung nicht als abschreckendes Beispiel für grüne Gentechnik. Im Gegenteil: Die gentechnische Veränderung war sehr gezielt und gut begründet. Und es wurden eben keine artfremden Gene übertragen.
Die Antimatschtomate ist auch deshalb ein Beispiel für eine bessere Gentechnik, weil der Verbraucher, der Konsument ein besseres Produkt bekommen sollte. Nämlich schmackhaftere Tomaten. Und das ist leider bis heute ein Einzelfall. Die meisten gentechnisch veränderten Pflanzen, die heute angebaut werden, haben keinen direkten Nutzen für den Verbraucher. Schädlingsresistente oder herbizidresistente Pflanzen haben zunächst vor allem Vorteile für den Bauern. Er kann besser Unkraut bekämpfen oder muss weniger Pestizide spritzen. Das kann natürlich indirekt auch dem Verbraucher zu Gute kommen, z.B. durch niedrigere Preise oder weniger belastete Früchte. Aber es gibt keinen unmittelbaren Nutzen: Kein besserer Geschmack, keine wertvolleren Inhaltsstoffe. Und auch deshalb fehlt die Akzeptanz in der Bevölkerung. Warum sollte ich eine gentechnisch veränderte Pflanze essen, wenn ich davon eigentlich keine Vorteile habe. Die Antimatschtomate hätte Vorteile gebracht. Aber warum war sie dennoch ein Misserfolg?
Warum die Antimatsch-Tomate ein Flop wurde
Auf diese Frage gibt es keine einfache Antwort, sondern viele Antworten. Es konnten z.B. nicht alle Ziele erreicht werden. Die Tomate war zwar deutlich länger haltbar, weil das Matschenzym nicht mehr aktiv war. Aber diese längere Haltbarkeit beschränkte sich auf die Zeit im Supermarktregal. Denn bei der Reifung wurde sie dennoch weich, und damit empfindlich gegenüber Stößen beim Transport. Die traurige Folge war, dass auch sie mehr oder weniger grün geerntet werden musste. Und damit war sie nicht viel aromatischer als herkömmliche Tomaten. Aber deutlich teurer. Der Vorteil für die Verbraucher war also geringer als erhofft. Ein weiterer Kritikpunkt war der Einsatz eines Antibiotikaresistenzgens bei der Entwicklung der Tomate. Dies war in der Frühphase der grünen Gentechnik üblich und notwendig. Die Risiken durch das Resistenzgens wurden durch öffentliche Stellen als vernachlässigbar eingeschätzt. Dennoch war es ein Ansatzpunkt für Kritik. In der heutigen grünen Gentechnik, die das CRISPR-Cas-Verfahren nutzt, kann auf den Einsatz von Resistenzgenen zum Glück verzichtet werden.
Zudem war die Diskussion über grüne Gentechnik in den 1990er Jahren wenig differenziert. Alles wurde in einen Topf geworfen und die grüne Gentechnik zum Teil kategorisch abgelehnt. Dabei kann man die Antimatschtomate nicht einfach so mit anderen gentechnisch veränderten Pflanzen vergleichen, z.B. mit glyphosatresistenten Sojapflanzen. Sowohl der gentechnische Eingriff als auch die Zielsetzung waren deutlich verschieden.
Doch es half nichts. Nach drei Jahren war die Antimatschtomate vom Markt verschwunden. Die Biotech-Firma Calgene geriet in finanzielle Schwierigkeiten und wurde ironischerweise Monsanto übernommen. Also dem Konzern der für die andere grüne Gentechnik stand: Mit glyphosatresistenten Sojapflanzen etc.
Welche Lehren kann man aus der Geschichte der Antimatschtomate ziehen. Vielleicht, dass grüne Gentechnik nicht per se gut oder schlecht ist. Diese pauschalen Aussagen helfen nicht weiter. Es geht um eine differenzierte Betrachtung. Man muss für jeden konkreten Fall anschauen, was gemacht wurde, wie es gemacht wurde und zu welchem Zweck es gemacht wurde. Und dann wird man wahrscheinlich feststellen, dass einige gentechnisch veränderte Pflanzen durchaus ihre Berechtigung haben. Gerade mit dem CRISPR-Cas-Verfahren ergeben sich neue Möglichkeiten für die Herstellung. Auf www.BiOfunk.net findet ihr eine Podcastfolge zu diesem Verfahren, außerdem eine Folge über Agrobakterium tumefaciens. Das ist die Genfähre, mit der Pflanzen gentechnisch verändert werden können.
Zur Podcastfolge
Podcastfolgen zum Nachlesen